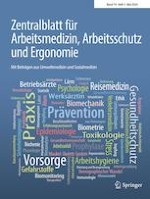Hintergrund
Für die Allgemeinbevölkerung zutreffende Herausforderungen | Zusätzliche berufsspezifische Herausforderungen |
|---|---|
Angst vor einer SARS-CoV‑2-Infektion Fehlinterpretation von Symptomen anderer Erkrankungen Konsequenzen der Infektionsschutzmaßnahmen Angst vor sozialen Konsequenzen (z. B. soziale Isolation aufgrund von Quarantäneregelungen etc.) Angst vor finanziellen Konsequenzen Unvorhersehbarkeit und Hilflosigkeit Verschlechterung von bereits bestehenden gesundheitlichen Problemen | Hoher arbeitsbezogener Stress Hohes Ansteckungsrisiko Stigmatisierung und sozialer Ausschluss Strenge Einhaltung von Infektionsschutzmaßnahmen während der Arbeit Trennung von nahstehenden Personen Reduzierte soziale Unterstützung Reduzierte Selbstfürsorge Umgang mit den intensiven Emotionen von Patient*innen/Bewohnenden Nicht ausreichende Krisenvorbereitung Rollenkonflikte und Verantwortungsgefühl |
Literaturrecherche
Ergebnisse
Herausforderungen während der Pandemie
Aspekte | Beispiele [Literaturquellen] |
|---|---|
A. Einrichtungsebene | |
Personal | |
Materialien | Verknappung an Medikamenten oder anderen medizinischen Produkten [4] Mangel an Testmöglichkeiten [16] |
(Gesetzliche) Regulation | |
Sonstige | Anstrengung um positive Außendarstellung [17] |
B. Führungskräfte | |
Personenbezogene Aspekte | Angst vor Ansteckung [10] Probleme in der Life-Domain-Balance [30] Angst, Betrieb nicht aufrechterhalten zu können [10] |
Arbeitsumfeld und Tätigkeit | Informationen, Regularien und Verordnungen Höheres Informations- und Erklärungsaufkommen [10] Erforderte Priorisierungsentscheidungen und Entscheidungsverantwortung [35] Personal- und Hygienemanagement Personelle Umverteilung [35] Umsetzung der Teststrategie [10] Sonstige Dezentrale Anwesenheit in der Einrichtung (auf unterschiedlichen Stationen) [30] Probleme in der transsektoralen Zusammenarbeit [35] Veränderung in der Arbeitsroutine [10] Konflikte im Pflegealltag [16] |
C. Beruflich Pflegende | |
Personenbezogene Aspekte | In Bezug auf Pandemiesituation Unsicherheit in Bezug auf Pandemieverlauf [43] Weniger Freizeit [43] In Bezug auf Arbeitstätigkeit Perspektivlosigkeit aufgrund langanhaltender Pandemiedauer [30] Angst vor Infektion (sich selbst, andere, Patient*innen/Bewohnende) [3, 4, 7, 10, 13, 16‐18, 22, 24, 25, 30, 33, 35, 38, 43] Fehlende Wertschätzung [38] Mangel an formaler Belohnung [9] |
Arbeitsumfeld und Tätigkeit | Pflege von COVID-19-Betroffenen Zeitweise eine Vielzahl an Patient*innen/Bewohnenden, die isoliert werden mussten [4] Erhöhter Versorgungsaufwand bei hohem Aufkommen von Betroffenen und Auftreten von schweren Verläufen [30] Übermäßig kognitiv belastende Arbeit [4] Lange Pflege unter Isolationsbedingungen ließ keine Möglichkeit zu, Grundbedürfnissen nachzugehen [4] Auf Normalstation: erhöhte Arbeitsbelastung durch kurze Verweildauer [30] Umsetzung der Teststrategie [10] Übernahme von professionsübergreifenden/fachfremden Aufgaben, z. B. aufgrund von Kompensation anderer Dienste (z. B. Logopädie, Ehrenamt, Physiotherapie) [4, 10] Technisierung der Versorgung [33] Hygienevorschriften Unsicherheit im Umgang der veränderten Hygienestandards [35] Sparsame Verwendung von knapper Schutzkleidung ohne Risiko der Selbstgefährdung [4] Spannungsfeld zwischen notwendiger Patient*innen‑/Bewohnenden-Versorgung, den Hygienevorschriften, den erlernten Hygieneregeln und des Eigenschutzes [4] Regularien und Vorgaben Geringe subjektive Informiertheit [13] Unplanbarkeit und Flexibilität Ständige Erreichbarkeit [10] Hohe Flexibilität (neue Fachbereiche, neue Kolleg*innen, neue Aufgaben etc.) [35]. Unverlässliche Dienstpläne aufgrund hohen und kurzfristigen Personalausfalls [30] Fehlende Schulungen/Qualifikationsmöglichkeiten Fehlende (kollegiale) Beratungen Keine Supervisionen oder ethische Fallbesprechungen [27] Wenn Supervisionen angeboten: durch Pflegekraft wenig angenommen [33] Überlanges Arbeiten, mangelnde Erholung Fehlende Pausen [10] Arbeiten in 12-Stunden-Schichten [35] Arbeitsbezogene Konflikte Rollenkonflikte [33] Konflikte im Pflegealltag [16] |
D. Teamebene | |
Zusammenarbeit | Konflikte unter Kolleg*innen [43] Fehlender professioneller Austausch [10] |
Arbeitsumfeld | Qualifikationsmix durch fachfremdes Personal [4] |
E. Pflegerische Interaktionsarbeit | |
Emotionale Konflikte, Sorgen in Bezug auf die Pflegebedürftigen | Starke Sorgen wegen langer Perioden der sozialen Isolation (z. B. keine Gruppenaktivitäten, gemeinsame Essen, Besucher*innen) [10, 33] Arbeiten mit Symptomen, aber Angehörige dürfen Patient*innen/Bewohnende nicht besuchen [4] Empfindungen der Pflegearbeit als De-Individualisierung und De-Humanisierung [33] Durch das Einhalten von Regularien (z. B. Testen, Schutzausrüstung, Kontakt zu Public-Health-Institutionen) gingen soziale Aspekte (wie Gruppenaktivität, Interaktionen) verloren [33] Sorge wegen physischem und mentalem Abbau der Bewohnenden sowie aufgrund von sozialem Rückzug von Bewohnenden [7, 33] Sorgen, gute Versorgung der Patient*innen/Bewohnenden unter den gegebenen Einschränkungen zu gewährleisten [3, 27] Schwierigkeiten, angemessene Sterbebegleitung zu leisten; z. B.: Keine Verabschiedung durch Pflegekraft möglich [33] |
Stark emotional fordernde Pflege | Belastung durch Ausbrüche, Erkrankungen und übermäßig hohe Todesfälle in kurzer Zeit und von teilweise vergleichsweise gesunden Patient*innen/Bewohnenden [7, 10, 33, 35] Umgang mit Ängsten der Patient*innen/Bewohnenden [4] Höhere Notwendigkeit, Gefühle zu verbergen [33] Konflikte mit Patient*innen/Bewohnenden [3] |
F. Versorgung der Patien*innen/Bewohnenden | |
Durchführung von Infektionsschutzmaßnahmen | Umsetzung bei dementen Personen (litten besonders unter Regularien: Gewichtsverlust, Aggressivität) [7, 33] Erschweren der Versorgung durch ständigen Wechsel von persönlicher Schutzausrüstung [33] |
Beeinträchtigte Pflegequalität | Einsatz von ungeschultem Pflegepersonal in COVID-19-Intensivstationen [13] (Teilweise) nicht ausreichendes Pflegepersonal, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten [13] Patient*innengefährdende Situationen [4] |
G. Angehörige | |
Interaktion und Zusammenarbeit | Zusätzliches Informieren über Gesundheitszustand der Patient*innen/Bewohnenden [33] Geändertes Besucher*innen-Management |
Allgemeine Herausforderungen und Arbeitssituation während der Pandemie
Ethisch-moralisches Spannungsfeld und gesteigerte Belastung bei Pflegenden mit direktem Kontakt zu COVID-19-Betroffenen
Positive Veränderungen
Diskussion und Schlussfolgerung
Gesundheit der Pflegenden
Limitationen
Arbeitsgestaltung und betriebliches Gesundheitsmanagement
Fazit für die Praxis
-
Beruflich Pflegende sahen sich während der COVID-19-Pandemie einer Vielzahl von Herausforderungen in verschiedenen Bereichen gegenübergestellt.
-
Führungskräfte stationärer Pflegeeinrichtungen sollten deshalb auch auf die Gesundheit der bei ihnen beschäftigten Pflegekräfte achten.
-
Langfristige Folgen der Belastungssituation während der COVID-19-Pandemie waren zum Erhebungszeitraum noch nicht absehbar. Ein Monitoring solcher negativen gesundheitsbezogenen Folgen sollte durch Instrumente wie eine systematische Gesundheitsberichterstattung oder Mitarbeiterbefragungen realisiert werden.
-
Gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung spielt bei der Reduktion von Belastung eine wichtige Rolle und sollte explizit gefördert werden; dies sollte insbesondere für den Fall zukünftiger Pandemien berücksichtigt werden.
-
Aktivitäten des betrieblichen Gesundheitsmanagements sollten vor, während und nach Krisenzeiten von den stationären Pflegeeinrichtungen weiterverfolgt werden.